Dies ist ein etwas längerer Text, über meine persönliche Beziehung zur Pride-Parade, Queerness und Feminismus, wie all das mein Leben lebenswerter machte, welche Selbsterkenntnisse es lieferte und welche Überlegungen ich davon ableite.
Die Euro-Pride-Parade rollte und tanzte im vergangenen Pride-Month über die Ringstraße meiner Wohnortstadt Wien. Angeblich beteiligten sich ein halbe Million Menschen – sicherlich hitzebedingt mehr halbnackt als verkleidet, auch wenn große Wasserschläuche mit Sprühdüsen, die an vereinzelten Hydranten angeschlossen waren, für Spaß in nassen Klamotten sorgten. Die Musik war manchmal sogar gut. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wurde (laut Wikipedia) zum ersten Staatsoberhaupt überhaupt, das auf einer Euro-Pride eine Rede hielt.
Die Queere*-Community Europas gedachte damit dem Stonewall-Aufstand, zelebrierte ihre, vielerorts immer noch in Frage gestellte, Daseinsberechtigung oder wollte einfach nur a-dabei sein. Einige ihrer Mitglieder kritisierten schon zuvor die Kommerzialisierung des Events. Andere zeigten auf, dass queere Menschen, abseits der Parade, immer noch Angst haben müssten, sich als solche erkennbar zu machen. Und insbesondere asexuelle Menschen sehen sich, auch innerhalb der Regenbogenfamilie, teils ausgegrenzt, teils angefeindet. Zwischen den Truck-Anhängern der großen Sponsoren, mit der dröhnenden Elektro-Mucke und den muskulösen Schönlingen, scheinen also einige Pride-Fahnen und Stimmen unterzugehen, die nicht dem marketing-konformen Regenbogen-Image entsprechen. Auch an einem solchen Tag des queeren Stolzes, sehen sie sich mit Ängsten und Beschränkungen konfrontiert. Umso bemerkenswerter, wenn sie dennoch teilnehmen.
Eine persönliche Geschichte
Meine persönlichen Erfahrungen mit der Pride waren bisher überwiegend positiv. Das liegt vermutlich auch an dem Alter, in dem begann, mich als queer (an) zu erkennen und vermehrt in der LGTBQIA-Szene zu bewegen. Ich trat bereits mit einem ausreichend (leid-)geprüften Selbst-Verständnis in das queere Leben. Als weißer, mittelalter Cis-[Mann], bin ich zudem privilegierter als viele andere. Auch kann ich aufgrund meiner Entwicklungsgesichte jederzeit in den Hetero-Cis-Mann-Habitus wechseln, den ich so lange als Versteck und Panzer trug. Er dient auch heute noch meiner präventiven Selbstverteidigung. Weshalb ich, auch nach Verlassen des Regenbogens, relativ angstfrei und nicht ungeschminkt, Rock und Bauchfreies spazieren tragen kann (z.B. um Essen zu holen, nachdem ich, beim Herumtanzen den ganzen Tag, völlig darauf vergessen hatte).
Ich spürte es also erneut am eigenen Leib, wie wichtig solche öffentlichen queeren Veranstaltungen sind – diese Mischung aus Protest und Party. Zu selten hat mensch Gelegenheit, mit Gleichgesinnten die individuelle Selbstbestimmung stressfrei auszuleben – zumal mit der Masse einer Euro-Pride. Da bewegt sich das ganze Selbstverständnis mit, da wird der Tanz des glitzernden Körpers zum Ausdruck einer Selbstbehauptung, die das ganze Wesen durchdringt und hoffentlich darüber hinaus, in andere Ecken und Gassen der Gesellschaft getragen wird.
Die Straße hatte uns gehört, wenigstens für einen Tag im Jahr – ehe der Festival-Müll vom Asphalt gefegt, die Pride-Village vor dem Rathaus abgebaut, die Regenbogenfahnen wieder abgehängt wurden. Seit dem geht der öffentliche Alltag wieder weiter, hinter dessen patriarchalen Heteronormativität sich das queere Leben die meiste Zeit über versteckt.
Beginn eines Selbstfindungs-Trips
Die „Regenbogenparade“ hat seit einigen Jahren eine besondere Bedeutung für mich. Als ich sie 2015 mit meiner Tochter besuchte, fühlte ich mich genau so: nur wie ein Besucher, ein Angehöriger, ein Sympathisant. Und ich fragte mich, warum. Warum fühlte ich mich nicht als Mitglied dieser teils politischen, teils aktionistischen, teils kulturellen und jedenfalls existenzielle Interessen teilenden Gemeinschaft, obwohl ich mir meiner Bisexualität schon länger bewusst gewesen war – oder es zumindest angenommen hatte?
Diese eine Frage öffnete mir das Tor zu einem gewaltigen Bergwerk an verborgenen Antworten. Zum Beispiel, wie gravierend der Unterschied ist, zwischen Wissen und Bewusstsein. Es war der Beginn einer langen und schwierigen Reise ins Innerste meines Wesens, in die Tiefen meiner Seele und Gedankenmuster, weit in meine Vergangenheit und wieder zurück in meine Gegenwart. Durch dunkle Gänge drang ich in die Verbindungskanäle, Maschinenräume und Kontrollstationen von Staat, Politik und Gesellschaft vor. Ich begegnete auf diesen Wegen alten Freund*innen wieder, wie Feminismus und Gender-Studies. Und ich fand neue menschliche Freund*innen, die das Selbe taten; sowie neue Instrumente des kritischen Hinterfragens einerseits, andererseits zur erneuernden Bildung meiner Identität.
Im Grunde begann damals mit der Pride, an der ich, so weit ich mich erinnern kann, in Wien zum ersten Mal teilgenommen hatte, ein neues Leben für mich. Ein selbstbewussteres, gesünderes, lustvolleres, ein lebendigeres Leben. Denn die danach einsetzende Entwicklung erweiterte und revitalisierte nicht nur mein Selbst-Verständnis von sexueller Orientierung und Gender-Identität, sondern beeinflusste natürlich alles, was damit zusammenhängt.
Beispielsweise entdeckte ich meine latente Männerangst und die damit verbundenen Angst vor der eigenen Femininität. So konnte ich beide aufarbeiten, wodurch sich meine Kommunikationsfähigkeiten (nicht nur mit Cis-[Männern]) maßgeblich verbesserte. Und im neuen, queeren Selbst-Verständnis meiner eigenen Normalität, wurde mein ganzes soziales Auftreten selbstsicherer und offener.
Die Angst vor dem Unbekannten
Hier zeigte sich gut, dass die konkrete Gefahr von Außen – z.B. die Furcht vor möglichen Angriffen durch queer-feindliche Personen – nicht so schwer wiegt wie die unbewusste Angst vor einer verinnerlichten, abstrakten „Gefahr“, dem Fremden in mir. Ich hatte bereits in meiner Jugend keine Scheu, andere Männer in der Öffentlichkeit zu küssen. Vermutlich weil ich seit meiner Kindheit gewohnt war, ohnehin von anderen „Buben“ scheinbar grundlos angefeindet zu werden. Die äußeren, potenziellen Gefahren waren mir bewusst. Das erlaubte mir, Kontrolle über Situation zu behalten. Ich war kampfbereit.
Die unbewussten Ängste hingegen, die sich hinter gewohnten Reflexen und Coping-Mechanismen versteckten, warnten vor Kontrollverlust. Mensch hatte versucht, mich als [Mann] zu sozialisieren und war dabei weit gekommen. Das Zulassen und Zeigen von Eigenschaften, die dieser Männlich-Machung nicht entsprechen, hätte bedeutet, dass diese spontan, unbedacht und für mich unbewusst sichtbar werden könnten – im Gegensatz zu bewussten Handlungen wie Küssen. Jedenfalls war mein Unterbewusstsein davon überzeugt: Einfach nur ungehemmt Ich zu sein, sei gefährlich. Das Ich müsse unter Kontrolle, teilweise verborgen, bedingt unterdrückt bleiben.
Schließlich hatte ich gelernt, dass ich brennende Zigaretten und Schläge einstecken könne. Aber die sozialen Konsequenzen, die mögliche Ausgrenzung, die Blicke und Beurteilungen anderer, der Psychoterror, alles, was einem offenen queeren Leben folgen könnte, war ein unbekanntes Risiko, das sich einfach zu groß anfühlte. Und mein Unterbewusstsein hatte damit nicht ganz Unrecht.
Verschattung, Projektion und Angstbeziehungen
Der ganze Mist hatte nicht nur die erwähnte kommunikative Barriere zur Folge. Es machte auch mehr oder weniger offene Beziehungen zu heterosexuellen Cis-Frauen schwierig. Ich projizierte meine eigene Männerangst auf diese Frauen, machte mir Sorgen um sie; was durch mein ebenfalls unbewusstes Misstrauen, gegenüber dem Femininen im Allgemeinen und gewissen Frauen-Klischees im Speziellen, verstärkt wurde. Letzteres wird bedingt durch Ersteres: Da [Männer] eine – auch unsichtbare – Gefahr für das Feminine/Frauliche darstellen, wäre es unvernünftig, gefährlich und dumm, Femininität zu zeigen.
Diese unbewusste Logik machte keinen Unterschied zwischen mir – der sich als [Mann] betrachtete, weil er so betrachtet wurde – und [Frauen], von denen diese Femininität erwartet und im „Idealfall“, auch im Sinne gesellschaftsnormativer Konditionierung, belohnt wird. Femininität/Weiblichkeit im Allgemeinen erschien mir instinktiv als Entblößung, Angreifbarmachung, als Schwäche also, die andere Menschen leicht ausnützen können.
Dieses bedingt berechtigte Angst wurde verstärkt, durch die Verschattung eines Teiles meiner Persönlichkeit. Seine Projektion führte nicht, wie bei manchen, zur externalisierten Misogynie. Sie verursachte hingegen übertriebene Ängste um jene Frauen, die mir emotional entsprechend nahe standen und Misstrauen gegenüber anderen Männern, was sich vor allem durch meine Eifersucht ausdrückte. Das Irreführende dabei war, zu wissen, dass ich mir nicht alles einbilden konnte, was ich als gefährlich empfand – zugleich musste ich mir manches jedoch einbilden. Aber was war richtig, was war falsch?
Meine ersten Retter in der Not waren, in meiner Uni-Zeit, Feminismus und Genderforschung. Durch sie hatte ich wenigstens erkennen können, dass ich nicht (völlig) verrückt war. Meine bösen Ahnungen stimmten zu einem gewissen Teil. Meine Ängste und mein Misstrauen hatten also eine realistische Grundlage. Feministische Erkenntnisse förderten zwar zugleich meine Sorgen. Aber diese waren keine abstrakten oder ungewissen Befürchtungen mehr, die ich in einsamen Gedanken von eigenen Beobachtungen ableiten musste. Aus ihnen wurden zunehmend konkrete und verständliche Zusammenhänge – Kontext nicht nur der individuellen Problematiken, sondern auch der strukturellen Ungerechtigkeiten. Und diese beiden Retter kamen mir, auf meiner persönlichen queeren Selbstfindungs-Parade der letzten Jahre, erneut entgegen.
Scheinbare Widersprüche zwischen Außen und Innen
Queer-/Feministische Erkenntnisse waren und sind immer noch besorgniserregend, machen traurig und sehr, sehr wütend. Aber sie machen auch gewisse Probleme nunmehr bewusst begreifbar und angreifbar. Oft sind diese nur spürbar, jedoch aus individualistischer Perspektive schwer zu erfassen. Es ist nicht leicht, die Verbindung von strukturellen/systematischen gesellschaftlichen Problemen und individuellem Erleben und Handeln herzustellen. Oft liegt es an persönlichen Gewohnheiten, einer Komfortzone des Bekannten und Vertrauten, die den Leidensdruck betäubt, der notwendig wäre, um die eigene Benachteiligung deutlich – persönlich und emotional – wahrzunehmen. Die Sicht auf das Große-Ganze, die immer eine Sicht von Außen ist, und die Sicht auf das Innere, die Empathie voraussetzt, führen immer wieder zu scheinbaren Widersprüchlichkeiten.
Wie kann es z.B. sein, dass die intelligente, kritisch denkende, selbstbewusst auftretende Freundin sich in gewissen Situationen, gegenüber Cis-Männern, immer wieder (und scheinbar grundlos) klein macht, zurück hält, ihre Stärken zu zeigen, sich teils kindlich gibt? Und lassen sich diese und ähnliche Verhaltensweisen tatsächlich durch feministische Theorien erklären? Spiegeln sich in ihnen die Lebensumstände von Frauen wider, die ich liebe? Und was ist mit den Männern in meinem Leben? Welche Rolle spielen sie in dieser patriarchalen Gesellschaft? Einem System, von dem ich so lange glaubte, es von meinem Elfenbeinturm aus, durch ein Fernrohr zu betrachten. Während es mich in Wirklichkeit längst bei den Eiern hatte.
In dieser Auseinandersetzung mit Theorien aus Medien und der Lebensrealität der engsten und liebsten Menschen, droht einem zuweilen das Gehirn zu explodieren und das Herz zu brechen. Sie ist dennoch notwendig. Extrem schwierig ist sie auch, wenn Du die persönlichen Verschattungen und irrationalen Ängste nicht von den realen äußeren Einflüssen unterscheiden kannst.
Projiziere ich also mein eigenen Ängste auf meine Gefährtin, von der ich weiß, dass auch sie immer wieder ähnliche Probleme mit Männern hatte, beginne ich unter Umständen falsche Vergleiche zu ziehen. Ich stelle mir vor, dass sie, gegenüber gewissen Typen und Situationen, das Selbe empfinden müsste wie ich; und dass die Begriffe, die sie verwendet, um dies und jenes zu beschreiben, für sie genau das Selbe bedeuten wie für mich. So einfach ist diese angebliche „Nebensache“ aber nicht. Sexuelle Beziehungen – vor allem zu sich selbst – sind komplexe Angelegenheit. Und es gibt kaum etwas Hässlicheres und Ungesünderes auf diesem Gebiet als die zynische Banalisierung von Sex & Sexualität (I am looking at you, Porn!).
Probieren geht über Studieren
Bevor ich aber völlig abschweife: Um diesen Unterschied zwischen den eigenen und den fremden Schatten herauszufinden, muss mensch persönliche Erfahrungen in diesem Bereich sammeln. Mensch muss seine eigenen Schatten herausfordern. Nur so lässt sich eindeutig Licht ins Dunkle bringen, das Fremde vom bloß Befremdlichen scheiden und die Unterschiede, zwischen eigenen Gefühlen und fremden Emotionen, erfahrbar und spürbar machen.
Aber um solche Erfahrungen machen zu können, muss mensch einerseits erkennen können, dass die eigenen Verschattungen kein Normalzustand sind. Andererseits braucht mensch Unterstützung, Gleichgesinnte, die Gewissheit, dass mensch nicht allein ist und es dort draußen erfahrbare Antworten gibt. Eine queere Veranstaltung wie die Pride, hat die Macht, Dir die entscheidenden Fragen aus dem Unterbewusstsein zu hauen und Dir den Mut zu geben, nach den Antworten zu suchen.
Burnout im Theaterbetrieb
Menschen streben nach Eindeutigkeiten, sind zugleich aber natürlich und ständig mit Mehrdeutigkeiten konfrontiert. Die Hetero-Seite meiner Bisexualität war meine große, gesellschaftlich sanktionierte Komfortzone. Das schützte mich jedoch nicht vor Erwartungen, denen ich unbewusst glaubte folgen zu müssen, ohne ihnen vollkommen entsprechen zu können. Beispielsweise wurde meine Rolle als Vater zu einem Rollenspiel der heteronormativen “Maskulinität“ – also jener Sammlung an Qualitäten und Eigenschaften, die mit Mann- und Vatersein assoziiert werden; auch um die „Mutterrolle“ meiner Partnerin auszugleichen. Wodurch sich gut zeigt, wie ich, sobald ich keine offene Beziehung führe, über die gesellschaftliche Erwartung der Monogamie, unbewusst auch sehr schnell auch andere Normen übernehme.
Schauspielerei ist allerdings echte Arbeit; und wenn sie pausenlos und automatisch, nach Regie des Unterbewusstseins, das von kollektivistischen Prägungen beauftragt wird, auf der Bühne des Alltags geleistet wird, nimmt die bewusste Leistungsfähigkeit mit der Zeit ab. Mensch wird erschöpft – vor allem, wenn sich ein Mensch wie ich nie völlig mit [Männern] oder [Frauen] identifizieren konnte, dementsprechend nichts mit den jeweiligen exklusiven Zuschreibungen anzufangen wusste, sie akzeptierte, teils tolerierte, aber sie nie zu seiner Identität machen konnte.
Femininität als Qualität
Wenn mensch, aufgrund äußerer Unwahrheiten, innere Wahrheiten verdrängt, droht entweder der langsame seelische Verfall oder mensch wird zur Zeitbombe für seine Mitmenschen – oder beides.
In meinem Fall kamen zu den damit zusammenhängenden Beziehungsproblemen mit heterosexuellen Cis-Frauen, Beziehungs-Hemmungen gegenüber „echten“ Männern (homosexuelle inklusive). Das halbe Spektrum meiner Sexualität litt vor allem unter der Verdrängung meiner Femininität. Es war dadurch auch schwer, asexuelle Freundschaften mit Cis-Männern zu pflegen.
Femininität bedeutet nichts anderes, als der Ausdruck von Qualitäten und Eigenschaften, die, in der patriarchal bestimmten heteronormativen Ordnung, dem Weiblichen bzw. den Frauen zugeteilt werden, eigentlich aber gender-neutral sind. Dieses Spektrum an Emotionalität, Handlungen und Gesten, die meist mit Sanftheit, Fürsorglichkeit, Empathie oder Rücksichtnahme beschrieben und dem Femininen zugeschrieben werden, existieren völlig unabhängig von den Kriterien zur Feststellung der Gender- oder Geschlechts-Zugehörigkeit. Dennoch werden Menschen, von Geburt an – bzw. beim ersten Ultraschall-Anblick ihrer sichtbaren Geschlechtsorgane – die einen oder anderen Qualitäten tendenziell zu bzw. abgesprochen – mit dessen Folgewirkung sich manche Menschen besser, andere schlechter, im Laufe ihres Lebens arrangieren können.
Auf die Idee, dass mensch auch agender oder nicht binär sein kann und darf, muss mensch erst einmal kommen, wenn Informationen und Vorbilder fehlen – wenn mensch sich zudem ständig mit anderen (Alltags-)Problemen herumschlägt. Mir halfen zunächst queere Webcomics auf dem Lernweg, eine „andere Normalität“ denken zu können. Sexuelle Orientierung und Gender-Identität sind existenzielle Grundpfeiler des menschlichen (Da)Seins. Mein Fehler war lange Zeit gewesen, sie zu vernachlässigen. Bis zu jener Pride-Parade 2015.
Die letzte Europride erinnerte mich wieder daran, an diese Wirkung des Moments, in dem du Dich vollkommen frei und sicher fühlst, auf der Straße, in der Öffentlichkeit, in deinem individuellen Sein, der eigenen Identität und Erotik. Auch diese Magie ist nicht zu vernachlässigen. Sie ist befreiend. Sie half mir, neben Freundschaften und Kontakten mit anderen queeren Menschen, zu mir selbst zu finden. Und der Weg geht weiter.
Genderrollen als Behinderung in einer martialischen Gesellschaft
Erst unlängst lag ich in den Armen meiner Gefährtin und heulte Wasserfälle, im Bewusstwerden des ganzen unterdrückten Schmerzes, der sich so lange in mir angesammelt hatte. Der Schmerz wegen vieler Dingen, die Menschen auf mich, mein Leben lang, projizierten, nur weil ich in diesem Körper lebe (und ich bin mir bewusst, dass es die meisten Cis-Frauen, Trans*- und Inter*-Menschen diesbezüglich viel schwerer haben als ich).
Starre, normative (und internalisierte) Genderrollen sind eine Behinderung – eine, die zum Glück nur temporär sein kann. Daher ist es essentiell und existenziell wichtig, stolz zu sein auf das Ausbrechen ins Anderssein, pride zu entwickeln für die eigenen Queerness. Stolz ist quasi das Gegenteil von Scham. Scham bzw. Beschämung wiederum ist die emotionale Hauptwaffe des normierenden Kollektivs und seiner Akteur*innen, um Menschen in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbsterkenntnis zu sabotieren. Besonders Wirkmächtig ist Beschämung im Zusammenhang mit Sexualität – die ohnedies immer noch vielfach mit falschen Tabus und Mythen aufgeladen ist – wo sie auf perfide Weise jenes Missverstehen unter Menschen fördert, das „Zwangsheterosexualisierung (Judith Butler)“ und Patriarchat aufrecht erhält.
Pride und Queerness gehören zusammen, wie die Straße und der Protest. Beides muss sich nicht auf Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transmenschen, Intersexuelle oder Asexuelle beschränken. Wenn wir genauer hinsehen, erkennen wir: „Queer ist die Norm (Myripa)” – das heißt, in Wahrheit und damit dort, wo beherrschende Normen nicht zu finden sind.
Oder sie sollte es sein. Das Patriarchat geht, neben jeder Menge Narzissmus, einher mit einer immer noch martialisch geprägten Gesellschaft. Dessen Funktionalität folgt die Einteilung der Menschen in zwei „Geschlechter“, mit ihren jeweiligen Aufgabenbereichen. Die „Buben“ werden zu Kriegern erzogen, von [Frauen], die dazu erzogen wurden, sich hinter der Front um alles andere zu kümmern. Aber die Schlachten finden mittlerweile zuhause statt, zwischen Menschen, die in Gruppen eingeteilt werden, die dazu erzogen wurden, einander nicht zu verstehen.
Menschen, die, in ihrer wahren und innersten Natur, vollkommen den Normen und Idealen unserer Gesellschaft entsprechen, existieren nicht. Dennoch werden diese Nichtexistierenden als Maß aller Dinge und als Gefängniswärter für alle Existierenden eingesetzt. Wie kann das „normal“ sein? Es ist normal, anders zu sein. Und wo dieses Anderssein unterdrückt wird, entsteht – auf die eine oder andere Weise – Gewaltpotenzial, das sich instrumentalisieren und manipulieren lässt.
Queerheit
*Darum verstehe ich Queerness auch als erweiterten Begriff, der über die Abkürzung LGBTQIA hinausgeht. Letztere setzt sich aus unterschiedlichen Kategorien zusammen und schließt dadurch automatisch weitere Gruppen aus, die im Sinne der gemeinsamen Sache berücksichtigt werden sollten. Queer zu sein, bedeutet jener behindernden, unterdrückenden Norm nicht zu entsprechen und kann auch heterosexuelle Cis-Menschen mit einschließen, die ein anderes Verständnis von Sex und Beziehung, Mann- und Frausein haben, als es der gesellschaftlichen Prägung entspricht. Heterosexualität entspricht zwar der Norm, heterosexuellen Menschen allerdings nur, solange mensch sie in eine Schublade packt. Bei genauerer Betrachtung tendieren auch sie dazu, dieser zu widersprechen.
Homosexuelle, Trans*- und Inter*-Menschen definieren sich durch völlig verschiedene Bemessungen. Es ist ganz klar: Die sexuelle Orientierung ist nicht das Selbe wie Genderidentität oder Intergeschlechtlichkeit. Sie haben dennoch gemeinsam, dass sie im Widerspruch zu den vorherrschenden Normen stehen – durch diese Eigenschaften, mit denen sie ins Leben kommen. Aber erst wenn sie durch ihr Ausleben in Opposition zum Vorherrschenden treten, sind nicht läner als „straight“ wahrnehmbar. Dieses Dagegen-Handeln und Trotzdem-Leben macht Queerheit aus.
Dadurch verschwinden die einzelnen Kategorien und ihre Unterscheidungsmerkmale nicht. Sie bleiben wichtig und bedeutsam. Aber ihre Unterscheidung ist keine Herausforderung. Die Herausforderung besteht hingehen darin, gemeinsam anders sein zu können.
Wie auch immer mensch diese Überlegungen kritisiert, es ist wohl kaum abzustreiten, dass nicht das Aufspalten marginalisierter Gruppen in Homosexuelle und Bisexuelle und Asexuelle oder in radikalen Feminist*innen und Queer-Feminist*innen dem Ziel einer besseren, sichereren, lebenswerteren Gesellschaft für uns alle dient. Das Spalten dient bekanntlich den Herrschenden. Und wer auch immer auf der Pride mitmarschiert und tanzt, ist Teil dieser einen Bewegung und trägt zu ihrem Momentum bei – die opportunistischen Großkonzern-Sponsoren ebenso wie die Hetero-Cis-Partypeople auf Drogen. Deshalb danke ich auch allen queeren Menschen, die jene Parade ausmachen, die für mich – der kein Freund von Menschenmassen ist – immer wieder eine große Herausforderung, aber ebenso eine lebensverändernde Inspirations- und Kraftquelle darstellt.
Über die wunderbare Normalität des Andersseins will ich in Zukunft, an dieser Stelle sowie für mein Erosophie-Projekt schreiben. Bis dann!







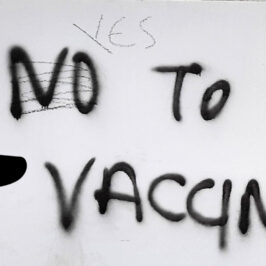
Schreibe einen Kommentar